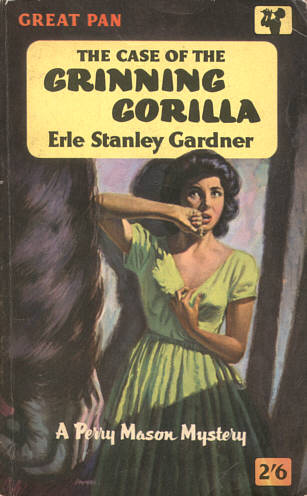Mit Genuss und Belehrung gelesen
Dienstag, 24. Februar 2004Willi Winkler ist einer der SZ-Schreiber, von denen ich alles lese. Die Geschichte über Fredl Fesl auf der heutigen Seite 3 der Süddeutschen Zeitung kommt in mein Archiv von vorbildichen Zeitungsartikeln, Abteilung Features. Allein der Aufbau: Die Geschichte hat einen Anfang, einen Mittelteil, ein Ende – scheint banal, ist aber selten. Sie tritt ihrem Gegenstand offen und mit Wohlwollen entgegen, will erzählen und informiert dabei. Mit Genuss und Belehrung gelesen.
Kurt Kister ist auch so einer, von dem ich alles lese, zu seinen Lebzeiten auch Herbert Riehl-Heyse selig.
Sofort muss ich aber auch an die Geschichten denken, die nie eine Chance hatten, weil sie tot redigiert wurden. Letzten Mittwoch stand ebenfalls auf der Seite 3 der SZ ein Artikel über den englischen Koch Jamie Oliver, die vermutlich ursprünglich gut war – Einstieg und Schluss lassen es erahnen. Doch alles dazwischen stinkt nach Kürzungen, Kürzungen Kürzungen – bis das Resultat nur noch dazu dient, das Viertel unter der Hauptreportage zu zu machen. Ganz schade.
Kann man lernen, gute Zeitungsartikel zu schreiben? Versucht überhaupt jemand, das dem Nachwuchs beizubringen?
Was man im Journalistik-Studium lernt, weiß ich nicht. Selbst habe ich mit 19 ein Volontariat bei einer kleinen Tageszeitung angefangen und einfach losgelegt. (Ich hatte derart wenig Ahnung vom Alltag in einer Zeitungsredaktion, dass ich mir in den Monaten davor glaubte Schreibmaschineschreiben beibringen zu müssen – vergeblich. An meinem ersten Arbeitstag war ich bodenlos erleichtert, als ich sah, wie so richtig erwachsene Redakteure mit zwei Fingern auf ihre Tastaturen einhämmerten.) Journalistikstudenten begegnete ich nur bei ihren Praktika in der Redaktion. Sie schwankten fast immer zwischen Melancholie und Überheblichkeit, weil sie keinen besseren, also prestigeträchtigeren Praktikumsplatz bekommen hatten, und konnten dem Charme einer Popelredaktion nichts abgewinnen. Die wenigsten davon waren nach vier Semestern Studium in der Lage, auch nur für die simpelsten Meldungen Überschriften zu machen. Einen Teil meines Volontariats verbrachte ich dann auch noch in einer Kleinststadt mit Uni inklusive Journalistik-Lehrstuhl. Mehrfach erlebte ich Journalistik-Studenten, die uns Käsblatt-Redakteure panisch um Unterstützung bei ihren Recherchen baten: „Ich muss den Artikel schon in ZWEI WOCHEN abgeben!!!“ (Die Kriegsgeschichten der Tagesaktualität hebe ich mir für einen sentimentalen Anfall auf.)
Ich glaube nicht, dass man mir im Volontariat ausdrücklich Schreiben beibrachte, aber ich weiß, dass sich zu dieser Zeit mein Sprachgefühl entwickelte. Redigieren schult sehr – allerdings wohl nur bei entsprechender Begabung. Mich trieb dieses Sprachgefühl letztendlich in die Arme der Literaturwissenschaft.
Der Schule wird es zumindest sehr schwer gemacht, gutes Schreiben zu lehren. Denn Noten gibt es auf Schulaufgaben-Texte, die zu vorgeschriebenem Zeitpunkt und in begrenzter Zeit zu fertigen sind. Die jungen Leute müssen ihr Können also unter Voraussetzungen beweisen, unter denen sonst nur Agenturmeldungen oder tagesaktuelle Berichte entstehen. Verlangt aber werden die Qualitäten eines Essays, über den man sinniert, dessen Gedankengang Tage der Entstehung braucht, mindestens eine Nacht Ruhen, dann Wiederlesen und Überarbeiten.
Von Lokalredakteuren höre ich übrigens in letzter Zeit, dass die Schreibfertigkeiten freier Mitarbeiter besser werden. Eine Erklärung könnte die weite Verbreitung von häuslichen PCs sein: Die Leute schreiben mehr und haben dadurch schlichtweg mehr Übung.